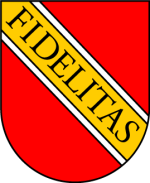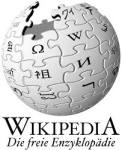Wir befinden uns in der Grünwettersbacher Straße, der früheren Hauptstraße nach Grünwettersbach.
Wir befinden uns in der Grünwettersbacher Straße, der früheren Hauptstraße nach Grünwettersbach.
Hier am Rande des alten Friedhofs entsteht der "Platz der Erinnerung"
Hier befindet sich die Stele Nr. 10
Thema A-Seite: "Platz der Erinnerung“ – Waldensernamen, Sammlung von Grabsteinen, Genealogie
Thema B-Seite: "Beerdigungskultur der Waldenser"
(Web-Schnellzugriff auf diese Stele: www.stele10.waldenserweg.de)
Die neue Seite "Platz der Erinnerung" mit der Sammlung von Palmbacher Grabmalen mit Waldensernamen finden Sie hier.
Die Beerdigungskultur der Waldenser
Die Beerdigungskultur der Waldenser ist geprägt von Schlichtheit und einem minimalistischen Ansatz. In ihrer ursprünglichen Heimat, den Waldensertälern, spielte die Bestattung keine zentrale Rolle. Die Waldenser hielten sich an einfache Beisetzungen, die ohne Totenmessen, Kerzen, Glockengeläut oder Grabsteine stattfanden. Traditionell fanden die Beerdigungen oft im Morgengrauen oder bei Einbruch der Dunkelheit statt, und es gab keine Pfarrer oder Angehörige, die dabei anwesend waren. Der Sarg wurde von einigen Männern der Gemeinde auf den Friedhof getragen und einfach in die Erde gesenkt und ohne jegliche Markierung zugeschaufelt. In der Überzeugung, die Seele war bei Gott, den Leib brauchte man nicht zu ehren, sahen die Waldenser keinen Grund, den Körper zu ehren. Dieser Gedanke spiegelt sich in der biblischen Aussage von Jesus wider: „Lasst die Toten ihre Toten begraben“ (Lukas 9,60).
Die Beerdigungen wurden in der calvinistischen Kirchenordnung als Familienangelegenheiten betrachtet, nicht als kirchliche Zeremonien. Auch der Reformator Calvin hatte in seinem Testament festgelegt, dass er nur von Freunden beerdigt werden wollte, ohne dass der Ort seines Grabes bekannt gegeben wurde. Im Laufe der Zeit wurde dieser Brauch etwas gelockert, und es war möglich, dass ein Pfarrer die Beerdigung begleitete, wenn die Familie dies wünschte.
Das Verbot von protestantischen Friedhöfen in Frankreich
Ein Erlass von 1662 verbot es den Protestanten in Frankreich, ihre Toten auf dem Gemeindefriedhof zu beisetzen, was zur Einrichtung von protestantischen Friedhöfen führte. Diese durften jedoch nur an Orten angelegt werden, wo die Religion noch praktiziert wurde. Von diesen existieren heute kaum noch Spuren, da viele in den Folgejahren zerstört wurden. Nach dem Erlass von Oktober 1685, der die Ausübung der reformierten Religion in ganz Frankreich verbot, begruben die Waldenser ihre Toten auf Privatgrundstücken. Ab 1724 war es den Protestanten in Frankreich wieder erlaubt, gemeinsame Beerdigungsplätze zu nutzen. Dennoch blieb der Brauch, die Toten auf dem eigenen Grundstück zu beerdigen, besonders in ländlichen Gebieten, lange Zeit erhalten.
Die Waldenser in Deutschland
Die Waldenser, die im Rahmen der Ausweisung in andere Länder, wie Deutschland, zogen, hielten an ihrer Tradition fest, ihre Toten in der Dämmerung zu bestatten. Im Laufe der Zeit passten sie sich jedoch den Bräuchen ihrer neuen Heimat an, behielten aber die Tradition bei, Grabsteine mit französischen Inschriften zu setzen. Die Waldenser, die 1699 nach Deutschland kamen, erlebten die Zerstörung ihrer Friedhöfe und bestanden darauf, eigene Gottesäcker und Grabstätten einzurichten, um ihre Traditionen zu bewahren.
Heute sind auf den Friedhöfen der Waldenserorte in Deutschland noch immer Spuren ihrer Geschichte zu finden, wie das Waldenserwappen, das an ihre Herkunft erinnert, auch wenn die Inschriften oft auf Deutsch, „mit dem Waldenserspruch „Das Licht leuchtet in der Finsternis“ verfasst sind. Gustav Meerwein berichtet im Jahre 1901 in seiner Ortschronik, dass der Palmbacher Friedhof ab der Ortsgründung an der jetzigen Stelle war und es zur Sitte wurde, die Toten nicht in der Reihe zu begraben. Jede Familie suchte sich auf dem Friedhof eine besondere Stelle für das Begräbnis aus. Im Jahre 1803 wurde diese Sitte vom Oberamt verboten. Nach und nach veränderte sich der Palmbacher Friedhof und die Beerdigungskultur nach den deutschen Gepflogenheiten.